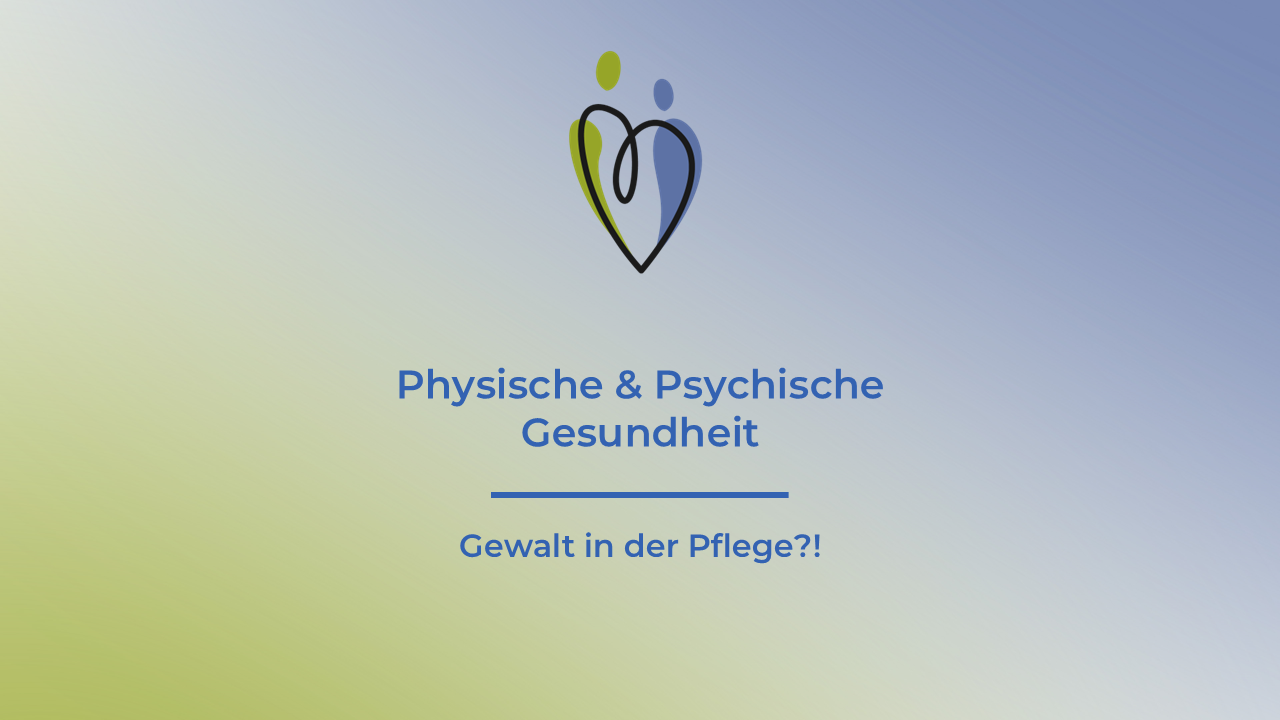Gewalt ist ein vielschichtiges Thema, das uns in unterschiedlichsten Lebensbereichen begegnen kann – auch in der Pflege. Gerade dort, wo Menschen aufeinander angewiesen sind, entstehen Situationen, die eskalieren können.
Doch was genau ist Gewalt, wie entsteht sie, und welche Formen gibt es?
Was ist Gewalt?
Gewalt bedeutet, dass jemandem gegen seinen Willen physischer oder psychischer Schaden zugefügt wird. Das kann durch Worte, Taten oder auch durch unterlassene Hilfe geschehen. Wichtig ist dabei: Gewalt beginnt nicht erst mit einem Schlag oder einer Verletzung – auch herabsetzende Worte, Kontrolle oder Einschüchterung können bereits Formen von Gewalt sein.
Wie entsteht Gewalt?
Gewalt ist oft ein Ausdruck von Überforderung, Hilflosigkeit oder einem bestehenden Machtgefälle. In der Pflege gibt es verschiedene Faktoren, die das Risiko für Gewalt erhöhen:
- Machtgefälle: Pflegebedürftige Menschen sind oft von ihren Angehörigen oder Pflegekräften abhängig. Diese Abhängigkeit kann dazu führen, dass Grenzen nicht respektiert werden – auf beiden Seiten.
- Überforderung: Wer pflegt, steht unter Druck. Der Alltag kann belastend sein, besonders wenn emotionale, körperliche oder finanzielle Belastungen hinzukommen. Ohne ausreichend Unterstützung steigt das Risiko, in Stresssituationen unangemessen zu reagieren.
- Verletzung der eigenen Schutzzone: Menschen brauchen Freiräume und Privatsphäre. Wer ständig für jemanden da sein muss und das Gefühl hat, nicht zur Ruhe zu kommen, kann sich in die Enge getrieben fühlen. Aus diesem Gefühl heraus kann es zu Reaktionen kommen, die als Gewalt empfunden werden.
Welche Formen der Gewalt gibt es?
Gewalt in der Pflege kann in vielen Formen auftreten:
- Physische Gewalt: Dazu gehören Schläge, Stoßen oder grober Umgang mit der pflegebedürftigen Person. Auch das Festhalten oder Vernachlässigen grundlegender Bedürfnisse kann in diese Kategorie fallen.
- Psychische Gewalt: Beleidigungen, Drohungen, Anschreien oder absichtliche Ignoranz können das Wohlbefinden massiv beeinträchtigen. Auch bewusste Isolation oder emotionale Erpressung gehören dazu.
- Strukturelle Gewalt: Oft wird diese Form übersehen. Sie entsteht, wenn Pflegekräfte oder Angehörige aufgrund von Überlastung keine angemessene Betreuung mehr leisten können – etwa wenn jemand nicht ausreichend bewegt oder ihm das Essen nicht richtig eingegeben wird.
Rechtlicher Bezug – Wo beginnt Körperverletzung?
Gewalt hat nicht nur emotionale, sondern auch rechtliche Konsequenzen. Im Strafgesetzbuch (StGB) ist Körperverletzung klar definiert und strafbar. Doch was passiert, wenn die pflegebedürftige Person geistig eingeschränkt ist? Hier gibt es besondere Schutzmechanismen.
- Das Wohl der pflegebedürftigen Person steht an erster Stelle. Wer Pflege übernimmt, hat eine besondere Verantwortung. Maßnahmen, die dem Schutz oder der Gesundheit dienen (z. B. Fixierungen oder medikamentöse Beruhigung), sind nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.
- Pflege darf nicht verunsichern. Angehörige sollen keine Angst haben, etwas falsch zu machen. Es ist wichtig, sich Unterstützung zu holen – sei es durch Beratungsstellen oder professionelle Pflegekräfte.
Was kann helfen?
Gewalt ist oft kein bewusstes Handeln, sondern das Ergebnis einer belastenden Situation. Es gibt viele Wege, um Gewalt zu verhindern:
✅ Belastung reduzieren: Unterstützung durch Beratungsstellen oder Pflegedienste kann Überforderung vermeiden.
✅ Grenzen respektieren: Sowohl Pflegende als auch gepflegte Personen haben das Recht auf Privatsphäre und Selbstbestimmung.
✅ Konflikte ansprechen: Wer merkt, dass die Situation kippt, sollte rechtzeitig das Gespräch suchen – mit Familie, Freunden oder Fachkräften.
✅ Schulungen und Austausch: Wissen hilft. Wer mehr über Gewaltprävention weiß, kann bewusster handeln.
Pflege ist eine Herausforderung – aber niemand muss sie allein bewältigen. Es gibt Wege, mit Überlastung umzugehen und Gewalt zu verhindern. Wenn du Unterstützung brauchst, gibt es Beratungsstellen, die helfen können.
Fazit:
Gewalt entsteht oft aus Stress, Machtgefälle oder Überforderung. Sie kann körperlich, psychisch oder strukturell sein und hat rechtliche Folgen. Doch mit den richtigen Strategien lässt sich das Risiko reduzieren. Der wichtigste Schritt ist, sich selbst und die Situation ehrlich zu reflektieren – und Hilfe in Anspruch zu nehmen, bevor es zu einer Eskalation kommt.
Dieser Beitrag wurde unterstützt durch:
Nik Landstorfer
1. Vorsitzender Kriminalitätspräventionsverein Get Ready 2 Defend e.V.
GR2D Krav Maga

Weitere Beiträge zum Thema Gewalt in der Pflege findest du hier: